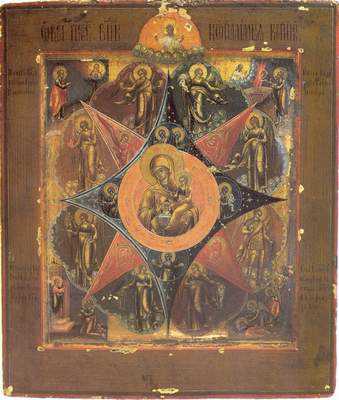 |
|
Bekannte Irrtümer Hätten Sie es gewusst? |
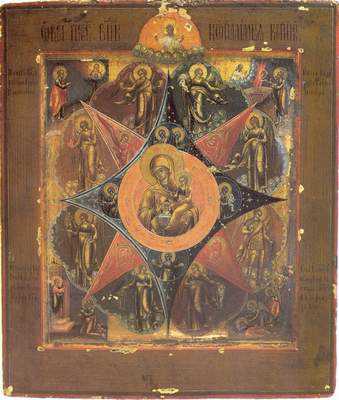 |
|
1.
Irrtum Marco
Polo Marco
Polo war in China Der
einzige Zeuge für diese Behauptung ist Marco Polo selber; in Wahrheit,
und anders als wir es aus Dutzenden von Büchern oder Filmen kennen, ist
Marco Polo vermutlich nie über Konstantinopel und das Schwarze Meer
hinausgekommen; er hat nie den Kublai Khan gesehen, ist nie dessen
Statthalter und Gouverneur gewesen, er war weder im Karakorum noch in
Peking noch in den meisten anderen Städten, die er in seiner »Beschreibung
der Welt« gesehen haben will. So lautet eine unter modernen Sinologen
ernsthaft diskutierte These. Mit anderen Worten, Marco Polo hätte den
Großteil seines Buches abgeschrieben oder frei erfunden (bzw. einem
Mitgefangenen in einem Kerker in Genua diktiert, wo er als
Kriegsgefangener vier Jahre Zeit zum Fabulieren hatte).
Diese These gründet
sich auf folgende Indizien: (1.) All die Dinge, die Marco Polo nicht
berichtet. Wer mehr als zehn Jahre in China herumgereist sein will, hat
natürlich die Große Mauer gesehen (und in der Tat muss Marco Polo,
wenn man seine angebliche Reiseroute nachvollzieht, mindestens einmal
diese Mauer überwunden haben). Aber Marco Polo erwähnt die Mauer mit
keinem Wort, genauso wenig wie die damals in China schon wohlbekannte
und weit verbreitete Buchdruckkunst: »Die Märkte der von Marco Polo
beschriebenen Städte müssen voll gewesen sein mit kleinen Bücherständen,
auf denen billig gedruckte populäre Handbücher und fiktionale Werke,
viele davon mit Illustrationen, feilgeboten wurden« (Wood). Auch die
typischen chinesischen Sitten des Teetrinkens oder des Essens mit den Stäbchen
oder des Einbindens der Füße bei den Frauen bleiben unerwähnt –
sehr ungewöhnlich für einen Reisenden, der jahrelang in dieser Gegend
und unter diesen Menschen gelebt haben will. (2.) Das Fehlen jeglicher
Hinweise auf Marco Polo in chinesischen Quellen selbst. Immerhin will
Marco Polo ja ein bedeutender Gesandter und Statthalter des Herrschers
gewesen sein; eine solche Figur verschwindet nicht ohne alle Spuren aus
der Geschichte eines Landes. (3.) Die Schwierigkeiten, die angebliche
Reiseroute nachzufahren. »Zwar gibt es auch heute noch Expeditionen,
die sich rühmen, den ›Fußstapfen Marco Polos‹ gefolgt zu sein,
doch namhafte Forschungsreisende geben zu, dass es nicht möglich ist,
über die Grenzen Persiens hinaus Marco Polos Route Schritt für Schritt
nachzuvollziehen« (Wood). (4.) Die seltsam unpersönliche Beschreibung
fremder Sitten, Städte oder Länder: »Kamul ist eine Landschaft, die
zu der großen Provinz Tanguth gehört; sie hat viele Städte und Burgen
und ist dem Großkhan untertan. « Und so weiter über Hunderte von
Seiten: »Tenduk (...) ist eine östliche Provinz mit vielen Städten
und Schlössern. (...) Sungui ist eine große und prächtige Stadt von
einem Umfang von zwanzig Meilen« usw. So schreibt man nicht über
selbst Erlebtes, so schreibt man über Dinge, die man aus fremden
Quellen abgeschrieben hat. (5.) Das Fehlen der Person des Marco Polo im
größten Teil des Buches. Passend zu der unpersönlichen Schilderung
der Landschaften und Städte ist nämlich von Marco Polo selbst in Marco
Polos Reisen kaum die Rede. In der Regel erscheint er, falls überhaupt,
nur in der dritten Person oder in der ersten Person Mehrzahl: »Messer
Marco ist lange in Indien gewesen. (...) Wenn der Reisende die Stadt
verlässt, reitet er sieben Tage über flaches Land. (...) Wir verlassen
nun Sengui und kommen zu einer anderen Stadt« usw. (6.) Der Aufbau des
Reiseberichtes selber. Auch wenn manche Übersetzungen »Die Reisen des
Marco Polo« heißen – das Buch ist alles andere als ein Bericht einer
Reise, eher ein Zettelkasten aus Anekdoten, Fakten, zugetragenen
Geschichten. Der Hauptteil des Textes beginnt mit einer ziemlich
sprunghaften Chronik des Mittleren Ostens, aus der man einiges über die
dort gehandelten Waren und die dort lebenden Menschen, aber nichts über
die konkreten Fahrten Marco Polos von einer Stadt zur anderen erfährt.
Es folgen geographische, ökonomische oder sozialpsychologische Exkurse,
wie sie für aus fremden Quellen und aus Erzählungen von anderen
zusammengeschriebene Bücher typisch sind. |
|
2.
Irrtum Magnetfeld Das
Magnetfeld der Erde zeigt seit jeher in die gleiche Richtung Das
Magnetfeld der Erde hat nicht immer seine aktuelle Richtung von Süden
nach Norden gehabt. In den letzten 4 Millionen Jahren hat es mindestens
neunmal seine Richtung gewechselt, das letzte Mal vor 730000 Jahren; das
kann man etwa aus Eisenpartikeln in erstarrter Lava sehen. Mit anderen
Worten, wäre damals ein Seefahrer stur der Kompassnadel nachgefolgt, wäre
er genau am Südpol angekommen.
Auch heute steht der magnetische Nordpol alles andere als still
– allein in diesem Jahrhundert hat er sich rund 500 Kilometer Richtung
Westen (von Europa aus gesehen) fortbewegt. Lit.:
Allan Cox u.a.: »Reversals of the earth's magnetic field«, Scientific
American, Febr. 1967. |
|
3.
Irrtum Mais Mais
ist ein Gemüse Mais
ist kein Gemüse, sondern so wie Roggen, Weizen, Hafer, Reis und Gerste
ein Getreide, d.h. eine Pflanze aus der Familie der Gräser. Unter »Gemüse«
und »Obst« versteht man die übrigen als Nahrungsmittel genutzten
Pflanzen (Erbsen, Möhren, Rüben usw.), wobei aber auch hier die
Einteilung nicht immer unumstritten ist. Bekannt sind etwa die Tricks
der alten DDR-Statistik, zu Zeiten von Gemüseknappheit die schweren und
reichlich vorhandenen Melonen statt dem Obst dem Gemüse zuzurechnen. Lit.:
W. Krämer: So lügt man mit Statistik, 7. Auflage, Frankfurt a.M. 1997;
Stichwort vorgeschlagen von Christelle Gelzus. |
|
4.
Irrtum Marathonlauf Der
Marathonlauf ist so lang wie der Weg von Marathon nach Athen Der
Weg vom Schlachtfeld von Marathon zum Marktplatz von Athen misst weniger
als 40 km, deshalb waren die ersten Marathonstrecken immer 25 Meilen
oder 39 km lang. Erst bei den Olympischen Spielen 1908 in London verlängerte
man die Strecke auf 26 Meilen 385 Yards bzw. 41 km 947 m, um der
englischen Königsfamilie ein bequemes Zuschauen von Schloss Windsor aus
zu ermöglichen. Und bei dieser Länge ist es dann geblieben. Lit.:
Stichwort »Marathon« (Sport) in der MS Microsoft Enzyklopädie
Encarta, 1994. |
|
5.
Irrtum Medizin Die
Medizin war schon immer ein Segen für die Menschheit Bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die typischen Ärzte für ihre
Patienten gefährlicher als die meisten Krankheiten. Erst um das Jahr
1910 herum, so meinen Medizinhistoriker, wurde die Wahrscheinlichkeit größer
als 50 Prozent, dass ein zufällig ausgewählter Kranker durch einen
ebenfalls zufällig ausgewählten Arzt gesundheitlich profitiert – bis
dahin hätten Ärzte also im Durchschnitt mehr Schaden als Nutzen
angerichtet (kein Wunder, wenn man noch tausend Jahre nach Hippokrates
die Leber für das Zentrum des Blutkreislaufs und das Händewaschen vor
einer Operation für eine Zumutung gehalten hat).
Bis weit in die Neuzeit haben daher nur Rossnaturen die Wohltaten
der Medizin überlebt. Wer heute auf alten Bildern den Barbieren und
Feldschern früherer Zeiten bei der Arbeit zusieht, erkennt auf einmal,
warum »Kunstfehler« eine Wortschöpfung des 20. Jahrhunderts ist –
entweder war man früher nach der Behandlung tot, oder der Körper half
sich selbst und der Patient war bald auch ohne Medizin gesund. Lit.:
Walter Krämer: Wir kurieren uns zu Tode, Frankfurt 1993. |
|
6.
Irrtum Meersalz Meersalz
ist gesünder und nahrhafter als herkömmliches Tafelsalz So
war und ist immer noch in verschiedenen Gesundheitsmagazinen
nachzulesen. Meersalz sei dem herkömmlichen Tafelsalz vorzuziehen, weil
es a) nicht raffiniert würde und daher »natürlicher« als dieses sei,
b) mehr nahrhafte Mineralstoffe enthielte und c) auch intensiver
schmecke.
Dazu Robert Wolke: »a) Unsinn, b) Unsinn, c) Unsinn«.
Das in Bioläden und Supermärkten verkaufte Meersalz ist im
Allgemeinen weder mineralstoffhaltiger noch weniger verfeinert als das
herkömmliche Tafelsalz, und es schmeckt auch völlig gleich. Denn auch
das »normale« Steinsalz aus der Erde, das heute in unterirdischen
Stollen abgebaut und dann vermarktet wird, stammt aus dem Meer; es ist
entstanden, als vor Millionen Jahren große Salzwasserflächen
austrockneten und von Sedimenten überlagert wurden; insofern ist es bezüglich
Rohstoff dem modernen Meersalz völlig gleich.
Wahr ist, dass bei dem Verdunsten von Meerwasser außer Salz (=
Natriumchlorid), dem mit rund 78% wichtigsten Anteil, auch noch
Magnesium- und Calciumverbindungen übrig bleiben (die restlichen 22%), plus
kleinste Mengen an über 70 weiteren chemischen Stoffen wie Phosphor
oder Eisen. Aber diese Stoffe sind für die Ernährung unerheblich. Um
etwa die Eisenmenge aufzunehmen, die in einer einzigen Weintraube
enthalten ist, müsste man ein Viertelpfund dieser so genannten »Meeresfeststoffe«
essen. Wegen des hohen Gehalts an Magnesium- und Calciumverbindungen
wird der Meeresfeststoff ferner genauso gründlich raffiniert wie jedes
andere Salz, damit am Schluss die gesetzlich geforderten 97,5%
Natriumchlorid zustande kommen (Ausnahme: Meersalz aus Frankreich; hier
ist der Natriumchlorid-Prozentsatz kleiner). Und der vermeintlich
intensivere Salzgeschmack des Meersalzes ist nichts als eine sensorische
Täuschung: Wegen der Flockenform der Meersalzkristalle lösen sich
diese in Wasser schneller auf als die Würfelkristalle des herkömmlichen
Tafelsalzes, erscheinen uns also salziger, wenn sie auf der Zunge
zergehen, obwohl in Wahrheit überhaupt kein Unterschied besteht. |
|
7.
Irrtum »Mens
sana in corpore sano« Diese
Worte des römischen Dichters Juvenal werden oft mit »In einem gesunden
Körper wohnt ein gesunder Geist« übersetzt und haben so Generationen
von teutonischen Turnfeldwebeln als Lizenz gedient, ihre Schüler mit
vormilitärischen Übungen zu traktieren.
In
Wahrheit hat Juvenal aber etwas ganz anderes gemeint. In seinen Satiren,
aus denen der obige Spruch nur unvollständig übernommen ist, schreibt
er ausführlicher: »Orandum est ut sit mens sana in corpore sano«,
oder auf deutsch: »Es wäre zu wünschen, dass in einem gesunden Körper
auch ein gesunder Geist stecken möge.« Das war aber nicht als
Lobeshymne, sondern eher als Angriff auf den damaligen, von Juvenal
zutiefst missbilligten Kult um körperliche Fitness zu verstehen. In
moderner Umgangssprache wäre sein Kommentar zu den gesalbten
Gladiatorenmuskeln der Römerzeit etwa wie folgt zu lesen: »Ach wie wäre
es doch schön, wenn diese Muskelaffen auch noch denken könnten. « Lit.: Georg Büchmann: Geflügelte Worte, Ausgabe Ex Libris, 6. Auflage,
Frankfurt 1991. |
|
8.
Irrtum Kolosseum Im
römischen Kolosseum wurden Christen abgeschlachtet Auch
wenn verschiedene Romane und Theaterstücke uns anderes erzählen (siehe
etwa »Androkles und der Löwe« von George Bernard Shaw): Im Kolosseum
wurden niemals Christen den Löwen oder irgendwelchen anderen Tieren
vorgeworfen, noch wurden sie hier ganz »normal« getötet. Die
Christen, die im alten Rom als Märtyrer gestorben sind, haben ihren Tod
woanders gefunden, nicht im Kolosseum. Lit.:
Stichwortartikel »Coliseum« in Catholic Encyclopedia, |
|
9.
Irrtum Abendrot Abendrot
verheißt schönes Wetter »Des
Abends sprecht ihr: es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist
rot«, sagt Jesus in der Bibel (Matthäus 16,2; in manchen Übersetzungen
fehlt die Stelle). Aber das stimmt nur bedingt. Richtig ist, dass ein
schwaches, pinkfarbenes Abendrot durch eine besonders trockene Luft
entsteht und dass deshalb die Wahrscheinlichkeit für Regen sinkt. Ein
knallroter Abendhimmel dagegen entsteht oft durch feuchte Staubpartikel
in der Atmosphäre; er kündet eher Regen an. Lit.:
Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift, Stuttgart 1929. |
|
10.
Irrtum Meter Ein
Meter misst einen Meter Der
Meter ist definiert als der Abstand vom Nordpol zum Äquator, geteilt
durch 10 Millionen. In diesem Sinn wurde der Meter im Jahr 1799 in
Frankreich eingeführt und dann durch Napoleon im übrigen Europa
verbreitet.
Allerdings
hatten die Erfinder des Meters die Entfernung zwischen Nordpol und Äquator
geringfügig unterschätzt – das Pariser Urmeter passt nicht 10
Millionen Mal, sondern 10 Millionen und 2000-mal hinein. Deshalb misst
ein Meter etwas weniger, als er nach seiner ursprünglichen
Begriffsbestimmung messen müsste.
Seit
1983 ist der Meter daher anders definiert, nämlich als die Entfernung,
die das Licht im Vakuum in einer Zeit von 1/299792458 Sekunden zurücklegt. Lit.:
Hätten Sie's gewusst?, Stuttgart 1992 (besonders der Abschnitt »Der
Meter – länger als gedacht«). |
|
11.
Irrtum Moses Immer
wenn Moses von Gott zurückkam, trug er Hörner Dieser
Irrtum folgt aus einem Übersetzungsfehler: Das hebräische »keren«
bedeutet sowohl Horn wie Strahl. In neueren Übersetzungen der einschlägigen
Bibelstelle (Exodus 34,35) ist dieser Irrtum korrigiert: »Wenn die
Israeliten das Gesicht des Moses sahen und merkten, dass die Haut seines
Gesichtes Licht ausstrahlte, legte er den Schleier über sein Gesicht,
bis er wieder hinaufging, um mit dem Herrn zu reden.« Lit.:
Die Bibel – Einheitsübersetzung, Stuttgart 1980; Linda Massey:
Michelangelo: sein Leben, sein Werk, seine Zeit, Stuttgart 1985;
Stichwort vorgeschlagen von Josef Stern. |
|
12.
Irrtum Ablass Die
Reformation ist aus Luthers Kampf gegen den Ablasshandel entstanden Es
ist eine weit verbreitete, aber falsche Ansicht, Martin Luther wäre vor
allem wegen seiner grundsätzlichen Ablehnung des Ablasshandels zu dem
großen Reformator geworden, als den wir ihn heute kennen. In Wahrheit
hatte Luther nur eine bestimmte Form des Ablasshandels, den zur
Finanzierung des Petersdoms in Rom ausgeschriebenen so genannten »Peterskirchen-Ablass«
angegriffen, den man anders als andere auch post mortem, nach dem Tod,
erwerben konnte (d.h. auch Tote waren aus dem Fegefeuer freizukaufen).
Außerdem mussten die Sünder ihre Taten noch nicht einmal bereuen –
schon das Geld allein sollte den Erlass der Sündenstrafen garantieren.
Hier sah Luther einen Missbrauch, den griff er in seinen berühmten 95
Thesen an.
Dass
dann aus dieser Meinungsverschiedenheit unter Theologen die evangelische
Kirche entstehen sollte, hat er vermutlich weder geahnt noch damals so
geplant. Lit.:
Gerhard Ritter: Luther, Frankfurt 1985; Gerhard Prause: Niemand hat
Kolumbus ausgelacht, Düsseldorf 1986 (besonders das Kapitel »Luthers
Thesenanschlag ist eine Legende«). |
|
13.
Irrtum Advent Die
Adventszeit umfasst die letzten vier Wochen vor Weihnachten Die
von den frühen Christen als Zeit der Buße und des Fastens und als
Vorbereitung auf das Weihnachtsfest gesehene Adventszeit währte anders
als heute je nach Land und Leuten von zwei bis sieben Wochen. Erst Papst
Gregor der Große (590–604) bestimmte eine für alle Christen
einheitliche Vier-Wochen-Frist (plus die Tage vom letzten Advent bis
Heiligabend, wenn Heiligabend selbst kein Sonntag ist); diese Frist
wurde auf dem Konzil von Aachen 825 auch offiziell für Deutschland gültig. Lit.:
Hartmut Schickert: Der kleine wissenschaftliche Adventsbegleiter, München
1997. |
|
14.
Irrtum Adventskranz Der
Adventskranz ist ein alter deutscher Weihnachtszeit-Begleiter Der
Adventskranz ist keine 150 Jahre alt; er wurde erst Mitte des 19.
Jahrhunderts von dem Pädagogen Johann Hinrich Wichern in das deutsche
Brauchtum eingeführt. Wichern hielt in seiner Einrichtung für
jugendliche Straftäter Adventsandachten ab, wegen der frühen Dämmerung
bei Kerzenlicht. Jedoch ließ er nicht alle Kerzen auf einmal brennen,
er begann mit einer Kerze am ersten Abend, zwei Kerzen am zweiten Abend
und so weiter. Die Kerzen für die Sonntage waren dabei groß und weiß,
die für die Wochentage klein und rot. Zum Aufstecken der Kerzen hing
ein Holzreifen von der Decke des Versammlungsraumes, in den
Anfangsjahren unbekränzt, seit 1860, dem offiziellen Geburtsjahr des
Adventskranzes, mit Tannengrün geschmückt. Etwa zur gleichen Zeit und unabhängig von Wichern hatte auch ein Pastor in Pommern damit begonnen, in seinen sonntäglichen Adventsandachten jeweils eine weitere Kerze anzuzünden, anfangs auf einem Weihnachtsbaum, später auf einem Kranz, und diese Sitte wurde schnell und flächendeckend auch von anderen übernommen. Die Symbolkraft dieses Kranzes – der Baum und das Grün als das Symbol des Lebens, der Kreis als das Zeichen der Ewigkeit, der Auferstehung und des Lebens, die Kerzen als der Hinweis auf das Licht, das in der Weihnachtsnacht die Welt erleuchten wird –, einer dermaßen geballten Ladung Tiefsinn konnte das Gemüt der Deutschen unmöglich lange widerstehen. Lit.:
H. Kirchhoff: Christliches Brauchtum im Jahreskreis, München 1990; »Ein
junger Brauch ist der Adventskranz«, Westdeutsche Allgemeine Zeitung,
27.11.1995; Stichwort vorgeschlagen von Michael Schmidt. |
|
15.
Irrtum Altar Der
Altar ist eine christliche Erfindung Die
ersten Christen kannten keine besonderen Plätze in ihren
Versammlungsorten, so wie in modernen Kirchen die Altäre. Sie wurden
sogar, weil sie keine Altäre hatten, von den anderen Religionen als
Barbaren angegriffen.
Der
Altar als der besondere Platz, wo man den Göttern opfert, existierte
lange vor Jesus Christus in fast allen Religionen dieser Erde. Lit.:
Stichwort »Altar« in Encyclopedia Britannica, 11. Auflage, Chicago
1910. |
|
16.
Irrtum Apfel Eva
hat im Paradies von einem Apfelbaum gepflückt Eine
verbotene Frucht namens Apfel kommt in der Bibel nirgends vor. In der
deutschen Einheitsübersetzung heißt es nur: »Die Frau entgegnete der
Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; nur
von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat
Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen, und daran dürft ihr nicht rühren,
sonst werdet ihr sterben.«
Wie aus diesem Baum, »der in der Mitte des Gartens steht«, ein
Apfelbaum geworden ist, weiß niemand so genau. Der Autor dieser
Bibelstelle hat sicher kaum an einen Apfelbaum gedacht – die gab es nämlich
im Nahen Osten damals nicht. Viel wahrscheinlicher wäre ein Feigenbaum,
denn Adam und Eva haben sich nach dem Genuss der Frucht mit Feigenblättern
zugedeckt.
Der Apfel geriet vermutlich über die Mythen der Griechen und
Kelten in die Bibel. Er galt bei diesen Völkern als ein Symbol der
Liebesgöttin, und da Sex für gute Christen etwas Böses ist, kann der
verbotene Baum ja nur ein Apfelbaum gewesen sein. Lit.:
Kurt Krüger-Lorenzen: Deutsche Redensarten – und was dahinter steckt,
Wiesbaden 1960; Bernd-Lutz Lange: Dämmerschoppen, Köln 1997 (besonders
das Kapitel »Sprachdenkmäler«). |
|
17.
Irrtum Archimedes Unter
den großen Taten des großen Archimedes sind auch einige, die man ihm
nur angedichtet hat. So lernt man oft noch in der Schule, Archimedes hätte
die römische Belagerungsflotte vor Syrakus mit Brennspiegeln in Brand
gesetzt.
Diese Tat ist aber nachweisbar unmöglich, wie moderne Ingenieure
bei dem Versuch herausgefunden haben, sie zu wiederholen. Zwar waren
Brennspiegel im Jahr 212 v.Chr., als die Römer im Lauf des zweiten
punischen Krieges die Stadt Syrakus in Sizilien belagerten, durchaus
schon bekannt – die Römer selbst etwa benutzten sie, um erloschene
Tempelfeuer wieder zu entzünden –, und man kann auch nicht ausschließen,
dass der große Tüftler und Erfinder Archimedes tatsächlich daran
dachte, solche Spiegel auch auf feindliche Schiffe zu richten. Aber
wenn, hat er den Gedanken sicher bald begraben, denn ein fahrendes
Schiff aus größerer Entfernung so in Brand zu setzen, ging über die
damaligen technischen Möglichkeiten weit hinaus.
Der römische Historiker Plutarch, der die sonstigen
Verteidigungsmaschinen des Archimedes ausführlich schilderte –
Wurfmaschinen oder Kräne etwa, um die römischen Galeeren auf Klippen
zu ziehen –, erwähnt die Spiegel nicht. 700 Jahre später in einer
Abhandlung über Hohl- und Brennspiegel des Anathemios von Tralles auf,
einem der Konstrukteure der Hagia Sophia in Istanbul, und dann nochmals
weitere 600 Jahre später in der Weltchronik des Mönches Johannes
Zonaras. Und seitdem sind die Brennspiegel des Archimedes aus dem
kulturellen Erben des Abendlandes nicht mehr wegzudenken. &
Lit.: Gerhard Prause: Tratschkes Lexikon für Besserwisser, München
1986; Stichwort »Archimedes« in Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage,
Mannheim 1987. |
|
18.
Irrtum Auge
um Auge Das
alte Testament fordert »Auge um Auge, Zahn um Zahn« Diese
immer wieder zur Rechtfertigung aller möglichen Rachegelüste
herangezogene Bibelstelle ist falsch übersetzt. Eine korrekte Übersetzung
wäre: »Der Schädiger muss dem Geschädigten etwas geben, das an die
Stelle des Gliedes oder Organs tritt, das nicht mehr seine volle
Funktion erfüllen kann« (Lapide). Diese Entschädigung wird von einem
Richter festgesetzt, mit Rache hat das nichts zu tun. Das Wort »um« in
»Auge um Auge« heißt »an Stelle von«, und in diesem Sinn, d.h.
Wiedergutmachung entsprechend dem zugefügten Schaden, wird und wurde
diese Bibelstelle von den Juden stets verstanden. Lit.:
Pinchas Lapide: Ist die Bibel richtig übersetzt?, Gütersloh 1989.
|
|
19.
Irrtum Biorhythmus Die
Menschen unterliegen einem Biorhythmus Diese
These geht auf Wilhelm Fliess zurück, einen Freund von Sigmund Freud,
der mit unserer Geburt drei jeweils 23 Tage, 28 Tage und 33 Tage lange
Zyklen starten sah, die, sich wellenförmig überlagernd, unser
Schicksal mitbestimmen. So die Theorie von Fliess. Insbesondere solle
man sich vor Nulldurchgängen dieser Zyklen hüten, den so genannten »kritischen«
Stunden oder Tagen, an denen eine dieser Wellen aus den positiven in die
negativen Werte wechselt. Hier sei die Lebenstüchtigkeit gefährdet,
das Risiko von Unfällen und Missgeschicken aller Art nähme, nach
Fliess, zu diesen Zeiten zu.
Diese
noch heute kommerziell verwertete Theorie ist aber wissenschaftlich
nicht zu halten; in mehreren Untersuchungen zu Biorhythmus und
sportlicher Leistung, zu Biorhythmus und Verkehrsunfällen oder zu
Biorhythmus und dem Sensenmann konnten keine Regelmäßigkeiten
aufgefunden werden. Das Schaubild auf S. 41 (mit freundlicher
Genehmigung entnommen aus Riedwyl und Widmer, 1976) zeigt z.B. sämtliche
10.480 amtlichen Selbstmordfälle in der Schweiz von 1961 bis 1970, auf
die Tage des Biorhythmus der Selbstmörder aufgeteilt: Keiner dieser
Tage, ob kritisch oder nicht, fällt in irgendeiner Weise aus der
Reihe. Lit.:
W. Dällenbach: »Zur Frage von Biorhythmen und deren technische
Anwendung«, Schweizerisches Archiv für angewandte Wissenschaft und
Technik 1948; W. Fliess: Der Ablauf des Lebens, Leipzig 1906; M.
Gardner: »Freud's friend Wilhelm Fliess and his theory of male and
female life cycles«, Scientific American 1967; L. Pircher: »Biorhythmik
und Unfallprophylaxe«, Zeitschrift für Präventivmedizin 1972; H.
Riedwyl und A. Widmer: »Zur ›Lehre von den Biorhythmen‹ nach Fliess«,
Sozial- und Präventivmedizin 1976; G. Schönholzer et al.: »Biorhythmik«,
Zeitschrift für Sportmedizin 1972; Stichwort angeregt von Hans Riedwyl. |
|
20.
Irrtum Blitz
1 Der
Blitz schlägt nirgends zweimal ein Dieser
verbreitete Irrglaube entspringt der gleichen Logik, wegen der ein
Mathematiker in Frankfurt einmal seinen Führerschein verlor: »Verrechnet
hatte sich in der Nacht zum Donnerstag ein 44jähriger Systemanalytiker
und Mathematiker, der von Beamten einer Polizeistreife gebeten worden
war, wegen starken Alkoholgenusses sein Fahrzeug stehen zu lassen«,
lesen wir in einer deutschen Tageszeitung. Der Wissenschaftler
versicherte, er würde sich von seiner Frau abholen lassen, schloss sein
Auto ab und ging. Als aber die Beamten kurz darauf an der gleichen
Stelle vorbeikamen, sahen sie ihren Freund am Steuer seines Autos
davonfahren. »Mit einer solchen Kontrolle hatte ich nicht gerechnet«,
entschuldigte sich der Delinquent. »Vorhin wurde ich zum allerersten
Mal überhaupt kontrolliert, und nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung
findet die nächste Kontrolle erst in hundert Jahren statt ...«
In Wahrheit ist die sog. bedingte Wahrscheinlichkeit, in der nächsten
Stunde kontrolliert zu werden, genau die gleiche wie die »normale«
Wahrscheinlichkeit: die Wahrscheinlichkeit für zwei Kontrollen in einer
einzigen Nacht ist zwar sehr klein, aber wenn man schon einmal
angehalten worden ist, steigt sie
ganz gewaltig an; sie ist jetzt so groß wie die
Wahrscheinlichkeit für nur eine einzige Kontrolle.
Daher
hat es auch keine Zweck, beim Fliegen eine Bombe mitzunehmen: »Was
haben Sie mit der Bombe vor?« fragt streng die Polizei. »Ich dachte
nur, zwei Bomben in einem Flieger sind doch extrem unwahrscheinlich«,
entgegnet der bekannte Witzbold, »und deshalb habe ich schon mal eine
mitgebracht ...«
Genauso ist auch die Wahrscheinlichkeit für zwei Blitze am
gleichen Ort zwar klein, aber die bedingte Wahrscheinlichkeit eines
weiteren Einschlages gegeben, der Blitz hat schon einmal eingeschlagen,
ist die gleiche wie die unbedingte, normale Wahrscheinlichkeit. (Das
Empire-State Building in New York wurde in den ersten 10 Jahren seiner
Existenz 68-mal vom Blitz getroffen.) Wer also bei Gewitter unter einen
gerade vom Blitz getroffenen Baum flüchtet, wird nur unnütz nass –
die Wahrscheinlichkeit, dass der Blitz dort nochmals einschlägt, ist
die gleiche wie den Baum zu treffen, unter dem man gerade steht. Lit.:
Stichwort »Lightning« in Microsoft CD- ROM Encyclopädie Encarta,
1994; W. Krämer: Denkste! Trugschlüsse aus der Welt des Zufalls und
der Zahlen, Frankfurt 1995. |
|
21.
Irrtum Bethlehem Jesus
wurde in Bethlehem geboren Jesus
Christus wurde nach Meinung fast aller modernen Bibelforscher in
Nazareth geboren; die These der Evangelisten Lukas und Johannes, Jesus
sei in Bethlehem zur Welt gekommen, sei eher als Versuch zu werten, die
Geburt des Messias dorthin zu verlegen, wo sie nach dem Willen des Alten
Testamentes stattzufinden hatte: in die Stadt Davids, in die Stadt, wo
David geboren und zum König wurde: »Aber du, Bethlehem-Ephratha, so
klein unter den Gauen Judas, aus dir wird hervorgehen, der über Israel
herrschen soll (...). Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft
des Herrn, im hohen Namen Jahwes, seines Gottes.« (Micha 5,1–3).
Also
schreibt Lukas: »So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa
hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er
war aus dem Haus und dem Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.« Aber außer
dieser einen einzigen Begründung – »er war aus dem Haus und dem
Geschlecht Davids« – hat Lukas und haben andere frühe Kirchenmänner
keine weiteren Indizien für diese Reise vorzuweisen, so dass man diese
wie auch Marias Niederkunft in Bethlehem als Fiktion und als
Versuch bewerten sollte, das Alte und das Neue Testament nachträglich
besser aufeinander abzustimmen. Lit.:
Die Bibel – Einheitsübersetzung, Stuttgart 1980; Stichwort »Bethlehem
(Jordan)« in der MS Microsoft Enzyklopädie Encarta, 1994; Hans Josef
Miller: »Abschied von Bethlehem?«, Katholisches Sonntagsblatt 50/1996,
S. 20. |
|
22.
Irrtum Davidstern Der
Davidstern ist ein altes jüdisches Symbol Der
sechszackige Davidstern, den die Juden unter der Naziherrschaft auf den
Kleidern tragen mussten, ist erst sehr spät, im 19. Jahrhundert, zu dem
Symbol des Judentums geworden, als das wir ihn heute kennen. Damals
begannen die Juden, diesen Stern als Kennzeichen ihres Glaubens auf
ihren Synagogen anzubringen, so wie die Christen auf ihren Gotteshäusern
ihre Kreuze.
Bis
dato hatte man dem Stern keine besondere Bedeutung beigemessen; er war
als eines von vielen magischen Symbolen auch in anderen Kulturen weit
verbreitet. Lit.:
Encyclopedia Judaica, Philadelphia 1971. |
|
23.
Irrtum Destilliertes
Wasser Wer
ausschließlich destilliertes Wasser trinkt, muss sterben Destilliertes
Wasser enthält keine Salze; nach einer verbreiteten Legende sollen
deshalb Menschen, die nur destilliertes Wasser trinken, ein Opfer der so
genannten Osmose werden: Von destilliertem Wasser umgebene Körperzellen
sollen sich demnach bei dem Versuch, durch Flüssigkeitsaufnahme den
Konzentrationsunterschied von Salzen innerhalb und außerhalb der Zelle
auszugleichen, derart voll pumpen, dass sie schließlich platzen.
Diese
Theorie ist aber allein schon deshalb falsch, weil Menschen den größten
Teil der nötigen Salze und Mineralien über feste Nahrung zu sich
nehmen, die sich dann im Magen mit Getränken aller Art vermengt. Mit
anderen Worten: Ob Mineral- oder destilliertes oder Kranenwasser, das
Wasser, das mit unseren Verdauungsorganen in Kontakt gerät, enthält
auf jeden Fall ausreichend Salz, um diese Osmose zu verhindern. Lit.:
Christoph Drösser: »Stimmt's? Wer destilliertes Wasser trinkt, stirbt«,
Die Zeit, 19.9.1997; Stichwort angeregt von Christian Kleiber. |
|
24.
Irrtum Diogenes Diogenes
lebte in einer Tonne Der
griechische Philosoph Diogenes von Sinope war ein Verfechter des
einfachen und anspruchslosen Lebens; zu Alexander dem Großen, der ihm
einen Wunsch freigegeben hatte, soll er geäußert haben: »Geh mir aus
der Sonne.«
Aber so weit, in einer Tonne seinen Haushalt aufzuschlagen, ging
Diogenes ganz sicher nicht. Diese Legende geht vermutlich auf den römischen
Philosophen Seneca zurück, der in seiner Biographie des Diogenes
schreibt, ein Mensch von derart anspruchsloser Lebensweise hätte wie
ein Hund genauso gut in einer Tonne leben können. Lit.:
R. Peyrefitte: Alexander der Eroberer, Hamburg 1982; Das große
Personenlexikon zur Weltgeschichte in Farbe, 2 Bände, Dortmund 1983; G.
Maurach: Senecas Leben und Werk, Darmstadt 1991. |
|
25.
Irrtum Dreizehn Die
Dreizehn ist die internationale Unglückszahl In
Japan ist die Unglückszahl die vier: Das Wort dafür heißt »shi« (=
Tod), man findet in ganz Japan kein Hotelzimmer und keinen Sitz im
Flugzeug mit der Nummer 4. In Italien ist nicht Freitag, der 13.,
sondern Freitag, der 17. der Unglückstag: Die römischen Ziffern für
17, also XVII, lassen sich zu »vixi« = lateinisch für »ich bin tot«
umstellen. Deshalb kann man in Italien auch keinen Renault 17 kaufen –
das Auto heißt dort Renault 117. Lit.:
Brockhaus – Wie es nicht im Lexikon steht, Mannheim 1996. |
|
26.
Irrtum Dudelsack Der
Dudelsack ist ein typisch schottisches Musikinstrument Der
Dudelsack kommt nicht aus Schottland; es gab ihn schon im alten
Griechenland. Auch in Persien, in China und im alten Rom (als »tibia
utricularis«) war er bekannt. Im Mittelalter kannten ihn die Franzosen
als »cornemuse«, die Italiener als »cornamusa« und die Deutschen als
»Sackpfeife«, und selbst in der Bibel wird der Dudelsack erwähnt: »Sobald
ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zithern, der Harfen, Lauten und Sackpfeifen
und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das
goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar errichtet hat« (Buch
Daniel, 3, 5).
Vermutlich kam der Dudelsack mit Caesar nach England und von dort
aus zu den Schotten, die noch heute gerne darauf spielen. Aber erfunden
haben sie die Pfeife sicher nicht. Lit.:
Stichwortartikel »Bagpipe« in Microsoft CD-ROM Encyclopädie Encarta,
1994. |
|
27.
Irrtum Ei
des Kolumbus Mit
dem »Ei des Kolumbus« meint man eine einfache Lösung für ein
scheinbar schwieriges Problem: Wie stellt man ein Ei auf seine Spitze?
Antwort: man kickt es auf, dann bleibt es stehen. So soll Christoph
Kolumbus, nach einem Bericht des Italieners Benzoni (Venedig 1565), auf
einem Bankett des Kardinals Mendoza 1493 diese Aufgabe gemeistert haben.
Schon
einige Jahre früher schreibt aber Benzonis Kollege Vasari diese Tat dem
Florentiner Filippo Brunelleschi zu. Brunelleschi hätte nach einer heißen
Diskussion mit Fachkollegen, wie denn die Kuppel des Florentiner Doms zu
bauen sei, die Bezweifler seines Plans gefragt: »Kann einer von euch
ein Ei auf seine Spitze stellen?« Natürlich wusste niemand eine Lösung.
Dann brachte Brunelleschi auf die bekannte Art das Ei zum Stehen und
sagte, genauso einfach wäre es, nach seinen Plänen eine Kuppel für
den Dom zu bauen.
Vermutlich
hat aber weder Brunelleschi noch Kolumbus diesen Geistesblitz erfunden;
in Spanien gab es schon viel länger die Redensart von »Hänschens Ei«:
»Das andere kennst du doch mit Hänschens Ei? Womit viele hoch erhabene
Geister sich umsonst bemühen, um auf einen Tisch von Jaspis solches
aufrecht hinzustellen; aber Hänschen kam und gab ihm einen Knicks, und
es stand« (Calderon, »Dame Kobold«). Vermutlich ist diese Geschichte
des aufgepickten Eis mit den Arabern nach Spanien gekommen. Lit.:
Fritz C. Müller: Wer steckt dahinter? Namen, die Begriffe wurden,
Eltville 1964; Georg Büchmann: Geflügelte Worte, München 1977. |
|
28.
Irrtum Eichenholz Eichenholz
ist das härteste unter den in Deutschland wachsenden Hölzern Die
Eiche ist bei weitem nicht der beste Lieferant von harten Hölzern. Härter
als Eiche sind zum Beispiel: Buchsbaum, Flieder, Rosenholz, Weißbuche
und Weißdorn. Am härtesten von allen hierzulande wachsenden Hölzern
ist das der Kornelkirsche. Lit.:
W. Lenz: Kleines Handlexikon, Gütersloh 1980; Stichwort vorgeschlagen
von Jürgen Kloppenburg. |
|
29.
Irrtum Einstein Einstein
war ein reiner Theoretiker Einstein
betätigte sich durchaus auch in angewandter Wissenschaft; in den 20er
Jahren hat er z.B., weil ihm die damalige Kühltechnik nicht gefiel,
mehrere Dutzend Kühlschrank-Patente angemeldet. (»Es würde mich
interessieren«, schrieb ein amerikanischer Patentanwalt, »ob dieser
Einstein der gleiche ist, der die Relativitätstheorie erfunden hat. «)
Die
ersten Kühlschränke, die damals noch giftiges Methylchlorid und
Schwefeldioxid zum Kühlen nutzten, waren eine Gefahr für Leib und
Leben. Einstein hatte in der Zeitung von einer Familie gelesen, die
durch diese aus dem Kompressor ausgetretenen giftigen Gase umgekommen
war, und hatte sich, um dergleichen Unglücksfälle zu verhindern,
zusammen mit seinem Studenten und nachmaligen Physikerkollegen Leo
Szilard verschiedene ohne Kompressor arbeitende Kühlschränke
ausgedacht, die das Erhitzen und Abkühlen des Kühlgases auf andere
Weise besorgten. Eines seiner Modelle ersetzte den mechanischen Kolben
durch magnetisch angetriebenes flüssiges Metall, ein anderes trieb den
Kühlkreislauf durch Hitze an, und wieder andere Modelle nutzten
Verdampfungskälte oder Wasserdruck; insgesamt meldeten Einstein und
Szilard mehr als 45 Kühlschrankpatente an.
Mindestens drei dieser Patente wurden von Elektrofirmen
aufgekauft (zwei von der schwedischen Firma AB Elektrolux, eines von der
deutschen AEG, die auch 1931 einen ersten Prototyp erstellte), aber es
kam nie zur Massenproduktion. Inzwischen hatten amerikanische Chemiker
ein ungiftiges Gas für konventionelle Kompressor- Kühlschränke
gefunden, und damit waren die Einstein-Kühler kommerziell nicht mehr
von Interesse. Dass dieses ungiftige, als FCKW bekannte Kühlschrankgas
aus ganz anderen Gründen später selber in die Schlagzeilen geraten
sollte, konnte damals niemand ahnen ...
Nach
seiner Übersiedlung in die USA setzte Einstein seine Exkursionen in die
Praxis fort; u.a. entwarf er für die amerikanische Marine einen Zünder
für Torpedos. Lit.:
G. Alefeld: »Einstein as inventor«, Physics today 33, 1980; L.G.
Danen: »The Einstein-Szilard Refrigerators«, Scientific American
1/1997; »Einsteins Kühlschrank«, Süddeutsche Zeitung, 30.1.1997; »Einsteins
Torpedos,« Der Spiegel 19/1998, S. 221. |
|
30.
Irrtum Einstein
war ein schlechter Schüler
In
Wahrheit war Einstein alles andere als ein schlechter Schüler; er war
nur an Sport und Sprachen wenig interessiert, und auch der Umgangston im
Unterricht gefiel ihm nicht: »Die Lehrer in der Elementarschule kamen
mir wie Feldwebel vor, und die Lehrer im Gymnasium wie Leutnants«,
schrieb er später.
Deshalb
und wegen seiner Verachtung für das Militär – »Wenn einer mit Vergnügen
in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn
schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn
das Rückenmark schon völlig genügen würde« – war Einstein bei den
Lehrern unbeliebt, aber diese Unbeliebtheit reichte nie, ihn sitzen
bleiben zu lassen oder von der Schule – dem Luitpoldgymnasium in München
– zu entfernen.
»Es
wäre nett, wenn du uns eines Tages verlassen könntest«, sagte ihm
einmal ein Lehrer, und auf Einsteins Einwand, er habe doch gar nichts
getan, erklärte er: »Deine Anwesenheit und deine träumerische und
gleichgültige Haltung gegenüber allem, was wir hier zu lehren
versuchen, untergräbt den Respekt der
Klasse.«
In diesem Sinn war Einstein also wirklich ein schlechter Schüler.
Aber seine Leistung in Fächern wie Mathematik und Physik, die ihn
interessierten, war immer erste Spitzenklasse..... Lit.:
Gerhard Prause: Genies in der Schule, Reinbek 1976. |
|
31.
Irrtum Einstein
hat den Nobelpreis in Physik für seine Relativitätstheorie bekommen Albert
Einstein hat den Nobelpreis für Physik von 1921 nicht für seine berühmte,
16 Jahre vorher veröffentlichte Relativitätstheorie, sondern für
seine Arbeiten zu den sog. photoelektrischen Effekten bekommen. Außerdem
erhielt er diesen Preis erst ein Jahr später, zusammen mit dem
Physik-Nobelpreisträger 1922, dem dänischen Physiker Niels Bohr. Lit.:
Chronik des 20. Jahrhunderts, Dortmund 1988. |
|
32.
Irrtum Eis Eis
ist glatt Eis
ist wie alle festen Körper überhaupt nicht glatt; die Moleküle an der
Oberfläche sind miteinander fest verbunden und erzeugen einen hohen
Reibungswiderstand.
Glatt
wird Eis erst, wenn es schmilzt – durch das Wasser auf der Oberfläche
nimmt die Reibung ab. So gleiten dann auch Schlittschuhläufer über das
Eis – nicht auf dem Eis selber, sondern auf einer dünnen Wasserpfütze,
die sie mit ihren Schlittschuhen durch die Reibungswärme erzeugen. Lit.:
Robert L. Wolke: Woher weiß die Seife, was der Schmutz ist? Kluge
Antworten auf alltägliche Fragen, München 1998. |
|
33.
Irrtum Engel Engel
haben Flügel Wo
immer diese Gottesboten im Alten oder Neuen Testament erscheinen, ist
von Flügeln keine Rede: »Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste«
(Genesis 16,7); »Der Engel Gottes, der den Zug anführte, erhob sich
und ging an das Ende des Zuges« (Exodus 14,19); »Der Engel des Herrn
kam und setzte sich unter die Eiche bei Ofra« (Richter 6,11); »im
sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa
namens Nazareth (...) gesandt« (Lukas 1,26) usw. Die einzigen
biblischen Gestalten mit Flügeln sind die Serafim und Cherubim, aber
das sind keine Boten Gottes, sondern Mitglieder des göttlichen
Hofstaates, die auch schon durch ihre Löwenleiber etwas aus der Rolle
fallen.
Demzufolge werden Engel in der frühchristlichen Kunst auch
durchweg ohne Flügel abgebildet. Erst ab Ende des 4. nachchristlichen
Jahrhunderts sieht man Engel auch mit Flügeln, vermutlich um ihr plötzliches
Erscheinen und Verschwinden wie auch die Auffahrt in den Himmel für die
Menschen nachvollziehbarer zu machen. In der Renaissance entwickeln sich
dann zusätzlich die beflügelten Mädchen- oder Kinderengel (Putten;
bis dato waren Engel durchweg junge Männer), und heute gehört der Flügel
zum Engel wie der Zylinderhut zum Schornsteinfeger. Lit.:
C. Westermann: Gottes Engel brauchen keine Flügel, Berlin 1957;
Engeldarstellungen aus zwei Jahrtausenden (Ausstellungskatalog),
Recklinghausen 1959; Wörterbuch des Christentums, München 1995. |
|
34.
Irrtum Eunuchen Eunuchen
sind unfähig zum Geschlechtsverkehr Das
hängt von der Art des Eingriffs ab, durch den man zum Eunuchen wird. »Im
allgemeinen bestand der Eingriff nur im Wegschneiden der Hoden«,
schreibt Werner Keller. »Da jedoch auch danach oft noch eine gewisse
Erektionsfähigkeit des Gliedes und damit die potentia coeundi bleibt,
wurde im Orient manchem Unglücklichen, vor allem, wenn er als Haremswächter
vorgesehen war, obendrein auch noch der Hodensack und der Penis
entfernt. Die wenigen, die diese fürchterliche Operation überlebten,
standen umso höher im Preis und waren sehr begehrt. « Lit.:
Werner Keller: Da aber staunte Herodot, München 1972; A.S. Ackermann:
Popular fallacies, Detroit 1995. |
|
35.
Irrtum Fegefeuer Schon
die Bibel droht uns mit dem Fegefeuer Anders
als viele Christen glauben, kommt das berühmte Fegefeuer in der Bibel
nirgends vor; weder im Alten noch im Neuen Testament ist von dieser »postmortalen
Läuterung« die Rede. Erst 200 Jahre nach Christus stellte ein
alexandrinischer Kirchenmann namens Origines die These auf, dass wir
nach dem Tod noch einer Läuterung bedürften (er gibt sogar exakte
Zahlen an: ein Jahr Fegefeuer für jeden Tag, den wir in Sünde auf der
Erde leben), und diese These ist dann peu à peu zur offiziellen
Kirchenlehre aufgestiegen. Lit.:
Theologische Realenzyklopädie, Berlin 1983. |
|
36.
Irrtum Fernrohr Das
Fernrohr ist eine Erfindung von Galileo Galilei Bekanntlich
hat Galilei im Januar des Jahres 1610 mit einem selbstgebauten Fernrohr
die Monde des Jupiters entdeckt. Aber erfunden hat er dieses Fernrohr
nicht. Vielmehr wird unter Experten der holländische Optiker Hans
Lipperhey als der eigentliche Erfinder angesehen; er hat nach alten
Protokollen der Generalstaaten schon 1608 um ein Patent dafür ersucht,
und vermutlich waren es einschlägige Gerüchte aus Holland, wo damals
neben Lipperhey auch andere Erfinder an einem Fernrohr arbeiteten, die
Galilei auf den Gedanken brachten, sich selbst ein Teleskop zu bauen.
Aber
schon mehr als 100 Jahre vor den Holländern und Galilei hatte Leonardo
da Vinci »dicke Brillengläser« zur Vergrößerung von Bildern
vorgeschlagen: »Mache Gläser für die Augen, um den Mond groß zu
sehen. « Und auch der italienische Physiker Giambatista della Porta
hatte schon mehrere Jahrzehnte vor Galilei ein Instrument erdacht, »um
aus der Ferne sehen zu können«. Lit.:
F.M. Feldhaus: »Fernrohre im Mittelalter«,
Geschichtsblätter für Technik und Industrie 5, 1918; W. Hübschmann:
»Leonardo da Vinci erfand das Fernrohr«, Zeitschrift für Naturlehre
und Naturkunde 16, 1968; Rolf Riekher: Fernrohre und ihre Meister, 2.
Auflage, Berlin 1990; Stichwort vorgeschlagen von J.V. Feitzinger und H.
Greßmann. |
|
37.
Irrtum Fingernägel Fingernägel
wachsen nach dem Tode weiter Entgegen
einem alten Aberglauben wachsen unsere Fingernägel nach dem Tode nicht
mehr weiter. Die Sorgen aus einer alten Germanensage sind also unbegründet:
»Kein Toter soll beerdigt werden, ohne dass jemand ihm die Nägel
schneidet; denn sonst wird das Schiff Naglfar schneller fertig.« (Das
Schiff Naglfar wird mit den Fingernägeln der Toten zusammengehalten.)
Hier noch ein paar andere einschlägige Legenden: Nägelschneiden
am Karfreitag ist gut gegen Zahnweh (alternativ: bringt Unglück, lässt
den künftigen Mann im Traum erscheinen etc.); Menschen mit krummen Nägeln
sterben früh; eine Schwangere, die über abgeschnittene Nägel läuft,
verliert ihr Kind; ein Säugling, dessen Nägel man hinter der Eingangstür
des Hauses schneidet, lernt gut singen (es sei denn, das Nägelschneiden
passiert montags – dann verliert das Kind früh alle Zähne); man muss
abgeschnittene Nägel tief vergraben, sonst holen einen die Hexen
(alternativ: dreimal draufspucken oder nochmals in drei Teile
schneiden); und so weiter. Jedoch hat sich nur der Glaube an das
Weiterwachsen nach dem Tode bis heute weltweit halten können. Lit.:
Sophie Lasne und Andre Pascal Gaultier: Dictionnaire des superstitions
(engl. Übersetzung: A dictionary of superstitions, Englewood Cliffs
1984). |
|
38.
Irrtum Fisch Fische
sind taub und stumm Viele
Fische können durchaus Schallwellen wahrnehmen; die nötigen Organe,
die sog. »Fischohren«, befinden sich in Kapseln hinter den Augen.
Manche, wie Knurrhahn, Tigerfisch, Krächzerfisch, Hornfisch, Katzenwels
und der gemeine Trommelfisch, erzeugen auch mehr oder weniger laute Töne
(um sich mit Artgenossen zu verständigen, aber auch um Feinde
abzuschrecken), die mit empfindlichen Mikrofonen aufgefangen werden können.
Dabei bedienen sie sich der Flossenknorpel, der Zähne oder ihrer
Luftblase. (Bei Katzenwelsen etwa wird die ausweichende Luft an
Membranen vorbeigeführt, die zu schwingen anfangen und damit Geräusche
hervorbringen.) Lit.:
Roland Michael: Wie, Was, Warum? Augsburg 1990. |
|
39.
Irrtum Flache
Scheibe Im
Mittelalter hielt man die Welt für eine flache Scheibe Seit
Aristoteles hält und hielt kein seriöser Gelehrter die Welt für eine
flache Scheibe. Insbesondere haben auch die gelehrten Mönche des
Mittelalters niemals und zu keiner Zeit behauptet, dass die Erde eine
Scheibe wäre. Von Beda Venerabilis (673–735) bis Thomas von Aquin
(1225–1292), von den Lehrern Karls des Großen bis zu den Beichtvätern
der Könige von Spanien und Portugal (die den Plan des Kolumbus, durch
Westwertssegeln Indien zu erreichen, als unmöglich abgewiesen haben
sollen, da man so vom Rand der Welt herunterfallen müsse): Kein maßgeblicher
Kirchenmann des Mittelalters hat je die Kugelform der Erde angezweifelt,
in keinem einzigen anerkannten, zwischen den Jahren 200 n. Chr. und 2000
n. Chr. erschienenen, ob von geistlichen oder weltlichen Gelehrten
verfassten Lehrbuch der Astronomie oder Physik ist je von einer flachen
Welt gesprochen worden.
Der
Kronzeuge der populären Theorie, dass man im Mittelalter die Welt für
flach gehalten hätte, ist der griechische Mönch Kosmas Indikopleustes
(Kosmas der Indienfahrer), der im 6. nachchristlichen Jahrhundert
vermutlich in Alexandria lebte und der nicht nur die Welt für flach,
sondern in strenger Auslegung diverser Bibelverse darüber hinaus auch für
viereckig und im Norden von einem hohen Berg begrenzt erklärte, um den
sich Mond und Sonne drehten. Verschwindet die Sonne hinter dem Berg, so
wird es Nacht; im Sommer steigt die Sonne höher, wegen des mit der Höhe
geringeren Umfangs des Berges werden dann die Nächte kürzer.
Und
so soll dann der Siegeszug der Dummheit angefangen haben: »Jeder, der
sich z.B. nur mit antiker Geographie befasst hat, kann ein Lied davon
singen, wie es eben die büffelhafte Borniertheit der Mönche war, die
über ihren christlich-topographischen Träumen fast sämtliche alten
Geographien verloren gehen ließen« (Arno Schmidt). »Unter dem
Einfluss des Christentums geriet die Erkenntnis von der Kugelgestalt der
Erde annähernd anderthalb Jahrtausend in Vergessenheit. Solange die
Erde als Scheibe angesehen wurde, war jede gegenteilige Lehre Ketzerei.
« (Dreyer-Eimbcke).
In
Wahrheit wurde die »Christianike Topographia« des Kosmas
Indikopleustes nie sehr ernst genommen; sie wurde weder ins Lateinische
übersetzt, noch sonst wie weit verbreitet, sie war nie die
Mehrheitsmeinung klerikaler Geographen. Niemand wurde im Mittelalter von
der Kirche zum Glauben an die flache
Erde angehalten, und so war auch bis weit in die Aufklärung von
klerikalen Flacherdenvertretern keine Rede; kein einziger der durchaus
antiklerikalen Rationalisten des 18. Jahrhunderts, weder Voltaire noch
Diderot noch Kant noch Hume noch Leibniz, hat dem Mittelalter, dem man
ansonsten alles Schlechte zutraute, diesen Irrtum vorgeworfen.
Der
moderne Mythos von den dummen Mönchen ist eine Schöpfung des späten
19. Jahrhunderts, als man fast zwanghaft jeden Fortschritt in den
Wissenschaften als einen Kampf zwischen klerikalen Dunkelmännern und
aufgeklärten Wissenschaftlern sehen wollte. Vor allem zwei Männer, der
amerikanische Arzt und Kirchenhasser John B. Draper (1811–1882) und
der Gründer der Cornell-Universität, Andrew Dickson White
(1832–1918), waren für dieses nachträgliche Umschreiben der
Wissenschaftsgeschichte verantwortlich. In seiner »History of the
conflict between Religion and Science« (mehr als 50 Auflagen seit 1874)
schreibt Draper: »Die Geschichte der Wissenschaften ist nicht allein
eine Geschichte isolierter Entdeckungen; es ist die Geschichte eines
Kampfes zweier rivalisierender Mächte, der vorwärts schreitenden Macht
des menschlichen Geistes auf der einen und des retardierenden
traditionellen Glaubens auf der anderen Seite. (...) Glaube ist von
Natur aus beharrend, Wissenschaft ist von Natur aus vorwärts strebend,
deshalb kann es zwischen diesen beiden keinen dauerhaften Frieden geben.
«
Und zum Beweis für diesen Kampf zwischen der vorwärts
strebenden Wissenschaft auf der einen und der »retardierenden«
Religion auf der anderen Seite streute Draper dann den Mythos von der
flachen Erde aus.
Dito
White. Anders als Draper sieht er zwar nicht die Religion an sich,
sondern die Heilsgewissheit mancher Kirchenmänner als die eigentlichen
Stolpersteine auf dem Weg des Fortschritts, aber letztendlich läuft
auch seine 1896 erschienene »History of warfare of Science with
theology in christendom« auf eine exklusive Verurteilung der Religion
hinaus. Und wie Draper macht auch White seine These an der angeblich von
Kirchenleuten propagierten flachen Erde fest.
Der
Erfolg dieser Kampagne ist noch heute weltweit nachzuweisen: Um 1870
z.B. war in keinem einzigen englischen Schul-Geschichtsbuch von der
mittelalterlichen flachen Welt die Rede – zehn Jahre später fast in
allen. Lit.:
Arno Schmidt: Kosmas oder Vom Berge des Nordens, Frankfurt a.M. 1955;
Oswald Dreyer-Eimbcke: Die Entdeckung der Erde, München 1988; J.B.
Russell: Inventing the flat earth, New York 1991; Rudolf Simek: Erde und
Kosmos im Mittelalter, München 1992; Stephen Jay Gould: The Dinosaur in
a haystack, London 1997 (besonders Kapitel 4: »The late birth of a flat
earth«); Eckhard Henscheid, Gerhard Henschel und Brigitte Kronauer:
Kulturgeschichte der Missverständnisse, Stuttgart 1997 (besonders der
Abschnitt »Scheibe, Kugel, Birne, Tisch«); Stichwort vorgeschlagen von
Hartmut Kliemt. |
|
40.
Irrtum Freitag,
der Dreizehnte Freitag,
der Dreizehnte hebt sich durch nichts Besonderes hervor Der
Dreizehnte eines Monats fällt öfter auf einen Freitag als auf jeden
anderen Wochentag.
Der
Kalender wiederholt sich alle 400 Jahre. Wenn wir, beginnend an
irgendeinem Tag, die nächsten 400 Jahre = 4800 Monate auszählen, haben
wir 4800 mal einen Dreizehnten des Monats, und der verteilt sich wie
folgt auf die Wochentage: Dienstag685 Mittwoch687 Donnerstag684 Freitag688 Samstag684 Sonntag687 Summe4800 Lit.:
J.O. Irwin: »Friday 13th«, The Mathematical
Gazette 55, 1971, S. 412–415. |
|
41.
Irrtum Friedenstaube Tauben
sind friedliche Tiere Tauben
sind durchaus nicht friedlich; in ihrer Rolle als Symbol des Friedens
sind sie eine klare Fehlbesetzung. »Außer am Marterpfahl der Indianer
hat wohl kaum ein anderes Lebewesen einem Artgenossen in solch
ausdauernder Kleinarbeit ähnlich grässliche, zu einem langsamen, fürchterlichen
Tod führende Wunden beigebracht« wie eine Taube.
Damit
spielt Vitus B. Dröscher, dem wir in diesem Stichwort folgen, auf ein
Experiment von Konrad Lorenz an; Lorenz hatte über eine kurze
Dienstreise sein Taubenmännchen Willy und sein Taubenweibchen Petra in
ein und demselben Käfig zurückgelassen, in der Hoffnung, so ihrer
Liebe etwas nachzuhelfen. Doch bei seiner Rückkehr war von Liebe keine
Rede: »Willy lag in einer Käfigecke auf dem Boden. Hinterkopf,
Oberseite des Halses und der ganze Rücken bis an die Schwanzwurzel
waren nicht nur völlig kahlgerupft, sondern so geschunden, dass sie
eine einzige Wundfläche bildeten. Auf der Mitte dieser Fläche, wie ein
Adler auf seiner Beute, stand das zweite Friedenstäubchen, Petra, die
›Braut‹. Mit dem versonnenen Gesichtsausdruck, der dem
vermenschlichenden Beobachter diese Vögel so sympathisch erscheinen lässt,
pickte das Vieh pausenlos in den Wunden des
buchstäblich ›Unterlegenen‹ herum. Raffte sich der auf, um
mit letzter Kraft zu entkommen, war die Amazone schon wieder hinter ihm,
klapste ihn mit den weichen Flügelchen zu Boden und setzte ihr
erbarmungsloses, langsames Tötungswerk fort, obwohl sie selbst davon
schon so müde war, dass ihr immer wieder die Augen zufallen wollten.«
Dieses Verhalten zeigen Tauben regelmäßig, wenn man mehr als
zwei in einen Käfig sperrt: Sie hacken so lange aufeinander ein, bis
einer oder eine nicht mehr lebt. Lit.:
Vitus B. Dröscher: Mit den Wölfen heulen, Düsseldorf 1978. |
|
42.
Irrtum Friedhof Friedhof
hat etwas mit »Frieden« zu tun Friedhof
kommt vom althochdeutschen »frithof« = Vorhof, Vorplatz, Vorraum einer
Kirche. Es bedeutet »eingefriedeter, beschützter Platz«. Da dieser
eingefriedete, beschützte Platz vor den Kirchen oft auch als Begräbnisstätte
diente, hat diese eingeschränkte Bedeutung peu à peu das Wort für
sich alleine in Beschlag genommen. Lit.:
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 2. Auflage, Berlin 1993. |
|
43.
Irrtum Geheimrat Ein
Geheimrat hat etwas mit Heimlichtuerei zu tun Ein
Geheimrat oder auch Geheimer Rat ist ein »Vertrauter Rat«. »Geheim«
hieß früher »zum Haus gehörig«, im Sinn von »vertrauenswürdig«;
erst viel später erhielt das Wort »geheim« auch die Bedeutung von
heimlich oder »streng vertraulich«. Lit.:
Duden – Herkunftswörterbuch; München 1989. |
|
44.
Irrtum Gehirn Intelligente
Menschen haben ein schwereres Gehirn als dumme Entgegen
einem alten Vorurteil hat das Gewicht unseres Gehirns nicht viel mit
dessen Qualität zu tun. Worauf es ankommt, ist in erster Linie die Zahl
der grauen Zellen in der Rinde unseres Hirns. Bei Männern wiegt das Gehirn im Durchschnitt 1375 Gramm; wie die folgende Tabelle zeigt, weicht das Gehirngewicht von Männern, die alle als begabte Denker galten, davon nach oben wie nach unten teils beträchtlich ab: Iwan
Turgenjew2012 g Otto
von Bismarck1807 g Immanuel
Kant1600 g Friedrich
Schiller1530 g Raffaelo
Santi1161 g Anatole
France1160 g Lit.:
Kleines Handlexikon, Gütersloh 1969. |
|
45.
Irrtum Gehirn Der
Mensch nutzt nur 10 Prozent seines Gehirns Sämtliche
Zellen unseres Gehirns sind auf die eine oder andere Weise an unserem
Denken und Erinnern beteiligt (das sieht man allein schon daran, dass
bei Ausfall eines Teils der Zellen immer irgendwelche Gehirnfunktionen
leiden). Vermutlich hatte Einstein, dem obige These zuweilen
zugesprochen wird, nur sagen wollen, zu einem gegebenen Zeitpunkt wäre
nur jede zehnte Zelle unseres Gehirns aktiv.
Das
mag stimmen oder auch nicht – in jedem Fall wird jede Zelle des
Gehirns und nicht nur jede zehnte Zelle wirklich auch gebraucht... Lit.:
Christoph Drösser: »Stimmt's? Der Mensch nutzt nur zehn Prozent seiner
Gehirnkapazität«, Die Zeit, 26.9.1997; Stichwort vorgeschlagen von
Christian Kleiber. |
|
46.
Irrtum Geld Unser
Geld ist durch Gold und Devisen der Zentralbank abgesichert Unser
Papiergeld ist genau das: Papier. Der Bäcker gibt uns dafür Brötchen,
und der Autohändler Autos, nicht weil diese Scheine einen Anspruch auf
einen Staatsschatz irgendwo in den Kellern der Bundesbank in Frankfurt
verbriefen – das tun sie nämlich nicht –, sondern weil er weiß, dass
er mit diesen Scheinen seinerseits etwas bezahlen kann.
Früher
war Geld, ob in Form von Gold, Silber, Kamelen, Muscheln oder
Zigaretten, auch aus sich selbst heraus geschätzt und wertvoll, und
deshalb haben viele Menschen auch heute noch die vage Vorstellung, dass
die Scheine in unseren Geldbörsen eine Art Ersatzgutscheine sind, um
uns das Herumschleppen des »echten« Geldes zu ersparen.
Diese
Zeiten sind aber lange vorbei. Im London des 17. Jahrhunderts, in den
Kindertagen des Papiergelds, stellten Juweliere ihren Kunden gegen Gold
Bescheinigungen des Inhalts aus, dass die Kunden jederzeit das Gold zurück
verlangen konnten; diese Scheine wurden später übertragbar und
ersparten damit den Besitzern bei größeren Transaktionen sehr viel Mühe:
statt des »echten« Geldes zahlte man mit Scheinen; dem Verkäufer war
das einerlei, denn er
konnte jederzeit beim Juwelier das »echte« Geld zurückverlangen.
Heute
dagegen bürgen weder private noch staatliche Notenbanken für
irgendwelche Werte hinter dem Papiergeld, das sie drucken. Als letzte
hat die amerikanische Notenbank die Verpflichtung widerrufen, jederzeit
zu einem festen Preis ihre Dollarscheine gegen Gold zurückzutauschen
(am 15.8.1971); seitdem verbrieft Papiergeld weltweit nur noch das
Recht, dass wir damit unsere Schulden abbezahlen dürfen (gesetzliches
Zahlungsmittel); davon abgesehen ist es aus sich selbst gesehen völlig
ohne Wert. Lit.:
E.V. Morgan: A history of money, London 1965, R. Sedillot: Muscheln, Münzen
und Papier. Geschichte des Geldes. Frankfurt 1995. |
|
47.
Irrtum Giftgas Giftgas
ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts (s.a. ð
»Flammenwerfer«) Mehr
als tausend Jahre vor dem Ersten Weltkrieg haben die Chinesen in Kriegen
Giftgas eingesetzt. Schon im 4. Jahrhundert hatten sie die Mittel, ihre
Feinde mit Rauch aus Senfgas zu betäuben: sie trieben den Rauch mit
Gebläsen auf die feindlichen Soldaten zu. Bekannt ist auch, dass die
Mongolen in der Schlacht bei Liegnitz 1241 die christlichen Ritter mit
»Dampfausstoßenden Kriegsmaschinen« in Erschrecken setzten. Lit.:
Walter Böttger: Kultur im alten China, Leipzig 1977. |
|
48.
Irrtum Ginseng Ginseng
hält jung Die
Wunderwurzel Ginseng wirkt ihre Wunder leider nur in der Reklame: »Irgendwann
trifft es jeden. Plötzlich merkt man, daß man nicht mehr so kann wie
früher. Jetzt heißt es: nicht den Kopf hängen lassen. « Und möglichst
viele teure Ginseng-Wurzeln essen. Denn »Ginseng ist ein Kraftquell zur
Stärkung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit«, es
macht müde Männer munter und lässt uns alle spritzlebendig 120
werden.
Nach
aktueller Mehrheitsmeinung der Ernährungswissenschaft ist das aber
alles Einbildung – im Großen und Ganzen enthält die Ginseng-Wurzel
nicht mehr und nicht weniger Wirkstoffe als viele andere Wurzeln auch;
ihre Popularität verdankt sie vor allem der Cleverness ihrer
Produzenten und der Dummheit ihrer Käufer. Lit.:
Arnold E. Bender: Health or hoax? The truth about health food and diets,
Goring-on-Thames 1985. |
|
49.
Irrtum Glühwürmchen Glühwürmchen
sind Käfer, keine Würmer. Es gibt mehrere Arten, in Europa am
bekanntesten die Lampyris noctiluca.
Das
Licht erzeugen die Glühwürmchen (übrigens nur die Weibchen) durch die
Reaktion von Luziferin, einer chemischen Substanz, und Sauerstoff, wobei
ein weiterer Stoff, Luziferasse, eine Katalysatorrolle übernimmt, d.h.
die chemische Reaktion als neutraler Begleiter unterstützt. Außerdem
bewirkt noch eine Schicht von Ammoniumnitratkristallen eine bessere
Streuung des Lichts.
Ein
besonders bemerkenswertes Glühwürmchen ist das Weibchen des
Phrixothrix, welches in Südamerika vorkommt: Es sendet sowohl rotes als
auch grüngelbliches Licht aus, entweder gleichzeitig oder abwechselnd.
Das Rotlicht kommt vom Kopf, das Grünlicht von einer Anzahl leuchtender
Organe am Leib. Lit.:
William C. Vergara: Das Blaue vom Himmel herunter gefragt, Augsburg
1993. |
|
50.
Irrtum Grünspan Auf
Kupferdächern kann man zuweilen Grünspan sehen Der
grüne Belag auf Kupferdächern ist kein Grünspan, sondern Patina.
Beides sind Kupferverbindungen, wenn auch von unterschiedlichem
Charakter: Grünspan entsteht durch die Verbindung von Kupfer mit einer
Säure (konkret: durch die Verbindung von Kupfer mit Essigsäure),
Patina (italienisch für Firnis) entsteht durch die Verbindung von
Kupfer mit einer Base (konkret: durch die Verbindung von Kupfer mit
basischen Karbonaten, Sulfaten und Chloriden). Und da Essigsäure in der
Atmosphäre nur in verschwindend kleinen Mengen vorkommt, entsteht der
Grünbelag auf Kupferdächern durch Basen und ist damit Patina. Lit.:
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, Berlin 1977; Stichwort
vorgeschlagen von Stefan Fassbinder. |
|
51.
Irrtum Gutenberg Gutenberg
war der Erfinder der Buchdruckkunst Schon
mehr als tausend Jahre vor Gutenberg wurden in China Bücher nicht mehr
handgeschrieben, sondern maschinell gedruckt. Anders als die Griechen
oder Römer, die auf Papyrus oder Vellum schreiben mussten, beides zum
Drucken nicht geeignet (Papyrus war zu zerbrechlich, Vellum zu teuer),
kannten die Chinesen seit etwa 100 v. Chr. schon das druckerfreundliche
Papier, und sie druckten auch darauf. Die ältesten noch erhaltenen,
noch mittels Holzrelief gedruckten Texte stammen aus dem 2. Jahrhundert
n. Chr. Ebenfalls noch per Holzrelief gedruckt wurden mehrere hundert
Jahre später die 130.000 Seiten der als »Tripitaka« bekannten Bibel
des Buddhismus, aber noch vor der Jahrtausendwende und damit mehr als
400 Jahre vor Gutenberg begann man, die im wahrsten Sinn des Wortes »en
bloc« in eine Holzplatte geschnitzten durch bewegliche Schriftzeichen
zu ersetzen.
Gutenbergs
Verdienst liegt also nicht in der Erfindung, sondern in der
Perfektionierung dieser Technik: Seine Schriftzeichen waren aus Metall,
die der Chinesen aus Holz; seine Druckerfarbe löste sich nicht in
Wasser, die der Chinesen löste sich in Wasser auf, und anders als die
Chinesen presste Gutenberg nicht das Papier gegen eine feste
Druckerplatte, sondern eine bewegliche Druckerplatte gegen das
festliegende Papier.
Und
dann hatte Gutenberg auch noch Glück: Während seine chinesischen
Konkurrenten mit mehreren Tausend Schriftzeichen zu kämpfen hatten (die
chinesische Schrift kennt keine Buchstaben, nur Zeichen für Silben oder
ganze Wörter; siehe Stichwort ð
»Chinesische Sprache«), waren es bei Gutenberg nur 26. Lit.:
Stichwort »Printing« in der MS Microsoft Enzyklopädie Encarta, 1994;
Stichwort vorgeschlagen von P. Häcker. |
|
52.
Irrtum Guter
Rutsch Wir
wünschen »Guten Rutsch«, um gut ins neue Jahr zu rutschen Unser »Guter Rutsch« an Silvester und an Neujahr kommt aus dem hebräischen »rösch« (= Anfang) und hat mit Rutschen nichts zu tun. |
|
53.
Irrtum Hals-
und Beinbruch Die
Floskel »Hals- und Beinbruch« hat etwas mit gebrochenen Knochen zu tun »Hals-
und Beinbruch« kommt aus dem jiddischen »hazloche und broche« = Glück
und Segen. Lit.:
Eckhard Henscheid, Gerhard Henschel und Brigitte Kronauer:
Kulturgeschichte der Missverständnisse, Stuttgart 1997 (besonders der
Abschnitt »Etymologie auf dem Holzweg«). |
|
54.
Irrtum Hamburger Die
meisten Engländer und Amerikaner, aber auch manche Schnellimbiss-Kunden
hierzulande glauben, »Hamburger« käme von Schinken = ham, so wie »Cheeseburger«
von cheese = Käse oder »Fishburger« von Fisch.
In Wahrheit hat der Hamburger seinen Namen tatsächlich von der
Stadt Hamburg. Ursprünglich ein einfaches Hackfleisch, so wie von den
Tataren Russlands im Deutschland des 14. Jahrhunderts übernommen (die
Tataren wollten durch das Kleinhacken vor allem das zähe Fleisch der
russischen Steppenrinder genießbarer machen; noch heute erinnern wir
uns daran mit dem »Beefsteak Tatar«), kam dieses mit deutschen
Auswanderern über Hamburg nach Amerika; dort klemmte man es dann,
vermutlich um Besteck zu sparen, nach dem Braten zwischen die zwei
Seiten eines aufgeschnittenen Brötchen.
Auf der Weltausstellung in St. Louis 1904 wurden dieses
Hackfleischbrötchen als »Hamburg« verkauft (noch ohne »er« am
Schluss); weniger später kam dann noch das »er« dazu, und so heißen
diese Hackfleischbrötchen heute noch Hamburger. Lit.:
Charles Panati: Universalgeschichte der ganz gewöhnlichen Dinge,
Frankfurt 1994. |
|
55.
Irrtum Heilige
Drei Könige Die
Heiligen Drei Könige, deren Gebeine man im Kölner Dom verehrt, sind
strikt gesehen keine Heiligen: ein Heiliger oder eine Heilige muss von
der Katholischen Kirche in einem eigenen Verfahren dazu erhoben werden,
und ein solches Verfahren hat es für die Heiligen Drei Könige nie
gegeben.
Auch
Könige sind die Herren Kaspar, Balthasar und Melchior nie gewesen –
in der Bibel ist nur von »Weisen«, »Magiern« bzw. »Sterndeutern«
die Rede. Und auch die Namen selber sind erfunden, sie werden in der
Bibel nirgendwo erwähnt; zum ersten Mal ist in einer um 500 nach
Christus in armenischer Sprache abgefassten Kindheitsgeschichte Jesu von
den drei Königen Melkon von Persien, Gaspar von Indien und Baltassar
von Arabien die Rede, vorher nicht. Der Evangelist Matthäus, der als
einziger im Neuen Testament von der Anbetung berichtet, erwähnt mit
keiner Silbe, wie die Anbeter heißen, oder wie viele es überhaupt
waren.
Dass
es drei gewesen seien, wurde aus den drei Gaben – Weihrauch, Myrrhe,
Gold – nicht ganz wasserdicht zurück geschlossen (oder man hat auch
nur die in der christlichen Mythologie so wichtige Zahl Drei auf die
Anbetung im Stall zu Bethlehem übertragen). Zu Königen wurden die
Sterndeuter erst in nachträglichen Interpretationen, u.U. wegen einer
missverständlichen Übersetzung von »Magier« (»König« meinte zu
Zeiten Jesu etwas ganz anderes als im Mittelalter, nämlich weit
weniger; fast jeder Vasall der Römer war damals ein »König«) oder
aber aufgrund einer Prophezeiung aus dem Alten Testament, wo es heißt:
»Die Könige von Tharsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen
...«
Nach Köln kamen die Könige bzw. deren Gebeine im Jahr 1158 auf
Veranlassung des Reichskanzlers und Kölner Erzbischofs Rainald von
Dassel; er hatte sie einem Reliquienhändler in Mailand abgekauft,
vielleicht sich auch von den Bürgern der Stadt Mailand schenken lassen
– die näheren Umstände des Erwerbs sind nicht genau geklärt. Die
Mailänder hatten die Reliquien angeblich Ende des 4. Jahrhunderts
selbst als ein Geschenk erhalten, und zwar vom Kaiser aus Byzanz, wohin
wiederum sie aus Palästina gekommen sein sollen, wo sie die Mutter des
Kaisers bei einer Pilgerfahrt gefunden haben will.
Aber
was tun die Gebeine der Sterndeuter in Palästina? So heißt es etwa in
der Bibel, die Weisen seien nach Anbetung in ihre Heimat, wahrscheinlich
das Zweistromland Mesopotamien, zurückgekehrt, so dass dort auch ihre
Knochen liegen. Und auch die Überführung von Konstantinopel nach
Mailand ist nur in
einer posthumen Biographie eines Mailänder Bischofs erwähnt,
der »Vita Eutorgii«, die mehrere hundert Jahre später ausgerechnet in
Köln entstand. Vermutlich hat also Rainald von Dassel als rechte Hand
des Deutschen Kaisers diese Legende einfach politisch ausgenützt, um im
damaligen Streit zwischen Papst und Kaiser seinem Herrn, dem Kaiser,
einen Vorteil zu verschaffen: die Könige, also die weltlichen
Herrscher, waren die ersten, die das Christkind anbeteten, und haben
deshalb, so die Logik Dassels, Vorrecht vor dem Papst. Daher ist auch
klar, warum die Partei des Papstes keine Eile hatte, durch eine
Heiligsprechung diese Sicht der Dinge zu befördern. Lit.:
Gerhard Prause: Tratschkes Lexikon für Besserwisser, München 1986
(besonders der Abschnitt »Drei Könige«); Konradin Ferrari
d'Occhieppo: Der Stern von Bethlehem in astronomischer Sicht, Gießen
1994 (besonders der Abschnitt »Über die Magier« auf den Seiten
133ff.). |
|
56.
Irrtum Hering Der
Hering ist ein reiner Salzwasserfisch Von
den rund 160 Heringsarten, die es heute gibt, leben einige auch in süßem
Wasser: Der Maifisch und der Kaspi-Hering etwa wandern weit in den
Oberlauf von Flüssen. Lit.:
W. Eigener: Großes Farbiges Tierlexikon, Herrsching 1982. |
|
57.
Irrtum Hornissen Ein
Hornissenstich ist besonders gefährlich Der
Stich einer Hornisse (Vespa crabro) ist nicht gefährlicher als der
Stich einer Biene oder Wespe; der Volksglaube, drei Hornissen könnten
einen Menschen töten, sieben gar ein Pferd, ist falsch. Entscheidend
ist allein, wohin die Hornisse sticht. Ein Stich in die Zunge oder in
die Lippe, in den Mund oder in ein Blutgefäß ist immer gefährlich,
aber dies gilt auch für eine Biene oder Wespe. In jedem Fall ist der
Stich einer Hornisse wegen des hohen Anteils von Serotonin, Acetylcholin
und Histamin im Hornissengift besonders schmerzhaft, und manche Menschen
reagieren auf das Gift allergisch. Lit.:
Grzimeks Tierleben, Bd. 2, Stuttgart 1969. |
|
58.
Irrtum Hundertjähriger
Krieg Der
Hundertjährige Krieg dauerte hundert Jahre Der
so genannte Hundertjährige Krieg, den sich die Franzosen und Engländer
im Mittelalter lieferten, dauerte in Wahrheit 114 Jahre, von 1339 bis
1453. Er begann, als die französische Königsfamilie der Kapetinger
ausstarb und der englische König Eduard III. den vakanten Thron
reklamierend, Frankreich England einverleibte. Die Franzosen wehrten
sich, und nach wechselvollen Kämpfen mussten sich die Engländer bis
1453 vollständig zurückziehen, sie behielten nur die Kanalinseln und
Calais (bis 1558 englisch). Lit.:
Stichwort »Hundertjähriger Krieg« in Brockhaus Enzyklopädie, 19.
Auflage, Mannheim 1990. |